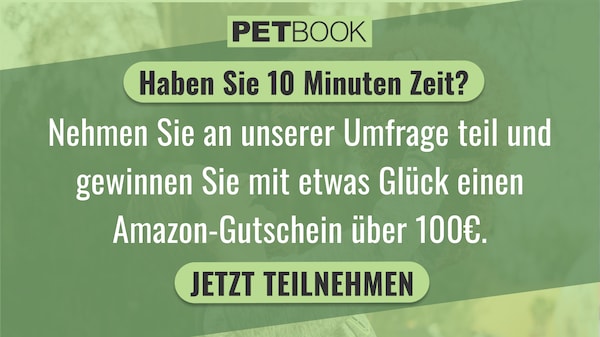23. April 2025, 16:09 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten
Ist die Beziehung zu unserem Hund wirklich besser als zu anderen Menschen? Eine Studie hat das genauer untersucht – und die Ergebnisse sind verblüffend. Hunde schneiden bei positiven Beziehungseigenschaften oft besser ab als engste Freunde oder sogar Familienmitglieder. Was steckt hinter dieser besonderen Verbindung zwischen Mensch und Hund?
Wer kennt den Spruch „der Hund ist der beste Freund des Menschen“ nicht? Allerdings ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund wohl noch komplexer und positiver besetzt als lange angenommen wurde. Denn alles, was Zweibeiner in der Interaktion miteinander stört, soll wohl beim Vierbeiner gar nicht vorkommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest, die das komplexe Beziehungsmuster zwischen Mensch und Hund mit neuer Methodik untersucht hat.
Haustier, Familienmitglied, Kind – oder etwas ganz anderes?
In westlichen Gesellschaften gelten Hunde längst nicht mehr nur als Haustiere, sondern als Familienmitglieder. Daher versuchen viele Studien, diese Bindung durch Kategorien wie „Haustier“, „Kind“ oder „Freund“ zu erfassen. Denn solche Labels vereinfachen die komplexe Realität. Die bislang gängige Erklärung basiert oft auf der Bindungstheorie (attachment theory), die ursprünglich zur Beschreibung von Eltern-Kind-Beziehungen entwickelt wurde.
Tatsächlich zeigen Hunde viele Verhaltensmuster, die mit kindlicher Anhänglichkeit vergleichbar sind, etwa die Suche nach Nähe oder Schutz bei Stress. Dennoch reicht diese Theorie nicht aus, um das gesamte Spektrum der Hund-Mensch-Beziehung zu erfassen. Um eine differenziertere Sichtweise zu ermöglichen, hat ein Forschungsteam der Abteilung für Ethologie an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest in Zusammenarbeit mit mehreren ungarischen Forschungseinrichtungen eine umfassende Studie zur Qualität der Beziehung zwischen Hund und Mensch durchgeführt.
Dafür nutzten sie ein neues theoretisches Rahmenmodell, das soziale Unterstützungsfunktionen in Beziehungen bewertet – und das über Tier-Mensch-Grenzen hinweg anwendbar ist. Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“. Die Forscher analysierten, wie Menschen ihre Bindung zu ihrem Hund im Vergleich zu verschiedenen menschlichen Beziehungspartnern bewerten – darunter Kinder, romantische Partner, beste Freunde und enge Verwandte.
Beziehung zu Hunden komplexer als bislang angenommen
Die Studie analysierte die Qualität der Hund-Mensch-Beziehung im Vergleich zu vier menschlichen Beziehungspartnern: Kind, romantischer Partner, bester Freund und engste verwandtschaftliche Bezugsperson. Insgesamt nahmen 717 Hundebesitzer an zwei Erhebungszeiträumen teil (2011–2013 und 2022–2023). Grundlage war das Network of Relationships Inventory (NRI-SPV), ein etabliertes Beziehungsinventar mit 24 Skalen, darunter Vertrauen, Zuneigung, Nähe, Konflikte und Machtverhältnisse – von diesen Skalen konnten insgesamt 13 auch auf Hunde angewendet werden.
Alle Teilnehmer bewerteten jeweils einen Hund und maximal vier Menschen aus ihrem engeren sozialen Umfeld. Zusätzlich wurden Alter, Geschlecht und weitere Daten zu Hund und Halter erfasst. Hunde schnitten in vielen Beziehungskategorien besser ab als menschliche Bezugspersonen – insbesondere bei „Zuneigung“, „Zuverlässigkeit“, „Fürsorge“ und „Gemeinsame Zeit“. Nur Kinder erreichten ähnlich hohe Werte wie Hunde, während romantische Partner, Freunde und Verwandte meist schlechter abschnitten.
In negativen Bereichen wie Konflikten und Antagonismus erhielten Hunde deutlich bessere Bewertungen als andere Partner – mit Ausnahme der besten Freunde, bei denen die Unterschiede geringer ausfielen. Besonders auffällig: Hundebesitzer empfanden ihre Beziehung zum Hund als deutlich weniger konflikthaft, dafür aber besonders verlässlich und bedeutsam. Auch die Machtverhältnisse waren asymmetrisch: Hunde ordneten sich stärker unter als Menschen, was möglicherweise zur Harmonisierung der Beziehung beiträgt.
Einzigartige soziale Bindung
Durch die Verwendung der neuen Skalenmodelle belegen die Ergebnisse, dass die Mensch-Hund-Beziehung eine einzigartige soziale Rolle einnimmt – eine Kombination aus elterlicher Fürsorge und freundschaftlicher Nähe. Der Hund fungiert für viele Menschen als Quelle emotionaler Stabilität, besonders durch seine verlässliche Präsenz und das Fehlen negativer Interaktionen.
Die Ähnlichkeit zur Eltern-Kind-Beziehung erklärt sich durch das Machtungleichgewicht und die Pflegeverantwortung. Gleichzeitig ähneln Hunde in ihrer Rolle oft gewählten Freunden, da sie als emotionale Unterstützer erlebt werden. Die Studie untermauert die Idee, dass Hunde nicht nur „treue Begleiter“ sind, sondern hochkomplexe soziale Rollen in unserem Leben einnehmen – vergleichbar mit den wichtigsten menschlichen Bindungen.
Die Untersuchung hebt sich durch ihren innovativen Vergleich von Mensch-Tier- und Mensch-Mensch-Beziehungen ab und bietet eine spannende Methodik. Allerdings basiert sie auch auf Selbsteinschätzungen, was Verzerrungen durch soziale Wünsche oder kognitive Voreingenommenheit nicht ausschließt.

Wissenschaftler definieren drei Arten von Hundebesitzern – welcher sind Sie?

Neue Studie identifiziert größte Vor- und Nachteile der Hundehaltung

Hunde erkennen bekannte Personen nur anhand der Stimme
Erarbeitetes Modell muss weiter getestet werden
Zudem war die Stichprobe stark weiblich geprägt (über 90 Prozent Frauen) und rekrutierte sich über soziale Medien einer interessierten Gruppe – was eine gewisse Positivverzerrung nahelegt. Auch wurde jeweils nur ein Hund und ein Mensch pro Kategorie bewertet, was die Vielfalt sozialer Netzwerke nicht vollständig abbildet.
Trotzdem liefern die Resultate fundierte Hinweise auf die emotionale Bedeutung von Hunden in menschlichen Beziehungssystemen. Sie zeigt eindrucksvoll, wie bedeutsam Hunde als soziale Beziehungspartner sind. Sie kombinieren Aspekte einer fürsorglichen Eltern-Kind-Beziehung mit der Verlässlichkeit enger Freundschaften – bei gleichzeitig minimalem Konfliktpotenzial.
Die Bewertung dieser Bindung über soziale Unterstützungsfunktionen eröffnet neue Perspektiven, die über klassische Bindungstheorien hinausgehen. Für Hundehalter liefert die Studie nicht nur wissenschaftliche Bestätigung ihrer Empfindungen, sondern auch Denkanstöße, wie tief und komplex die Verbindung zu ihren Tieren tatsächlich ist. 1